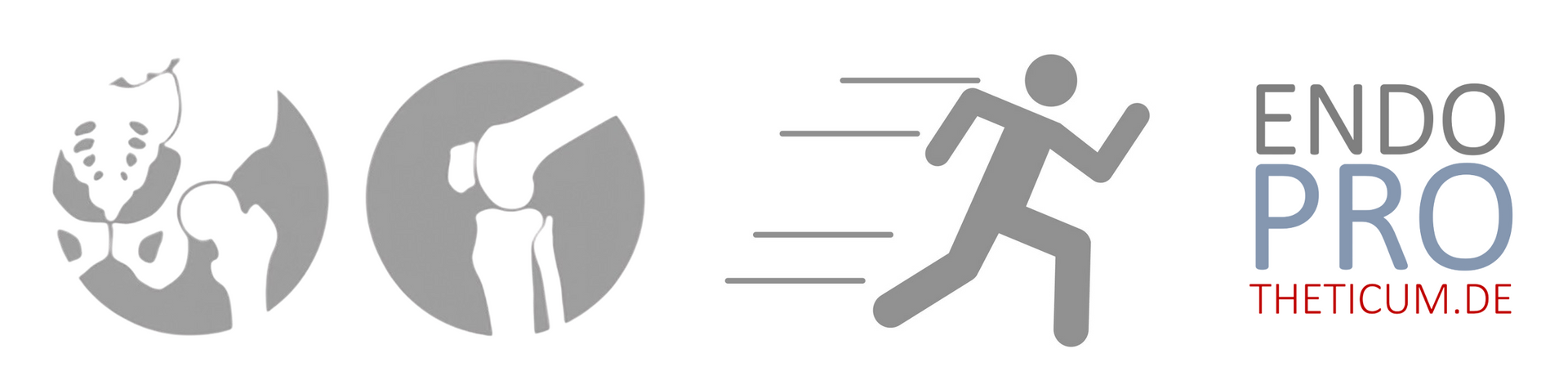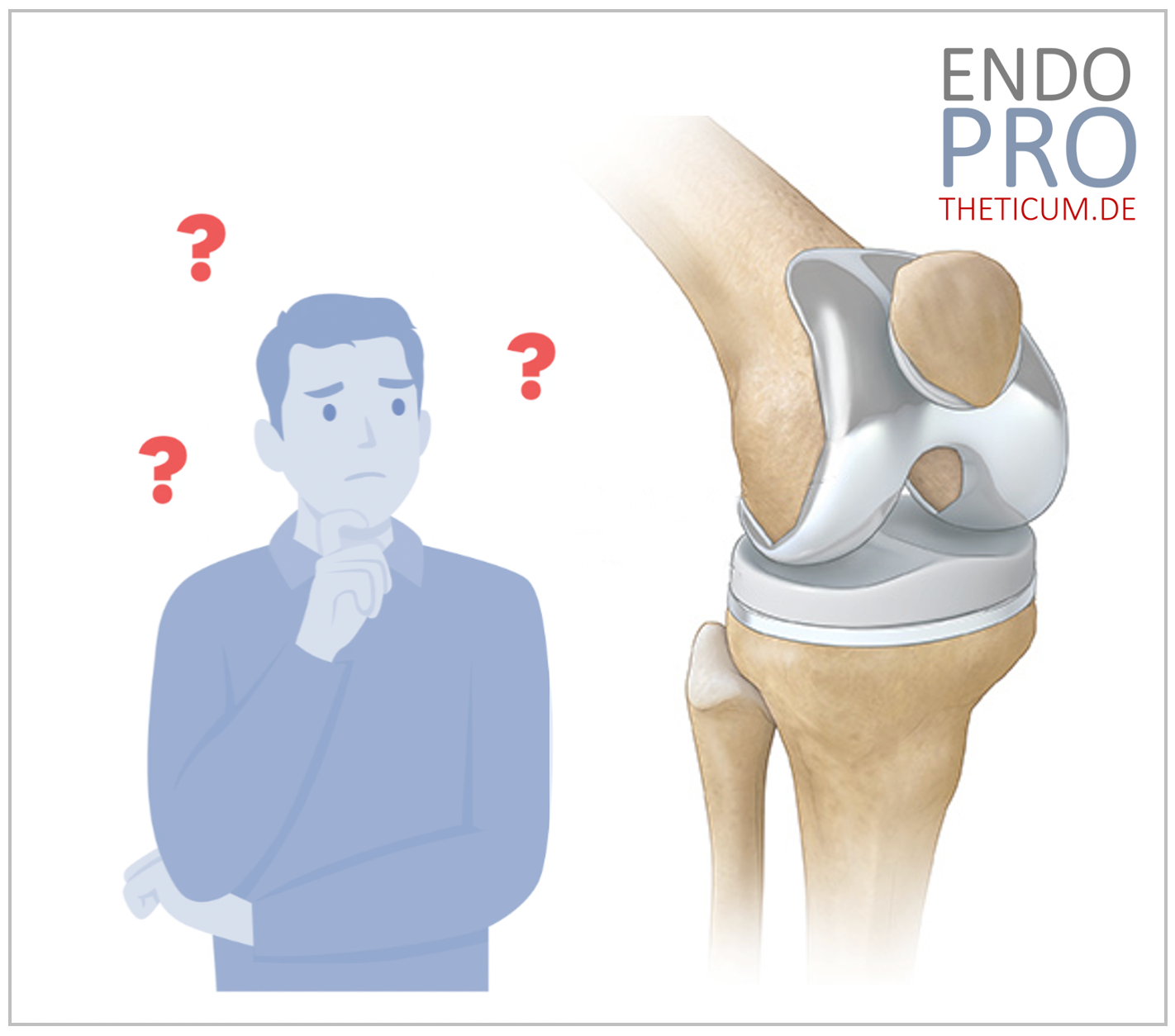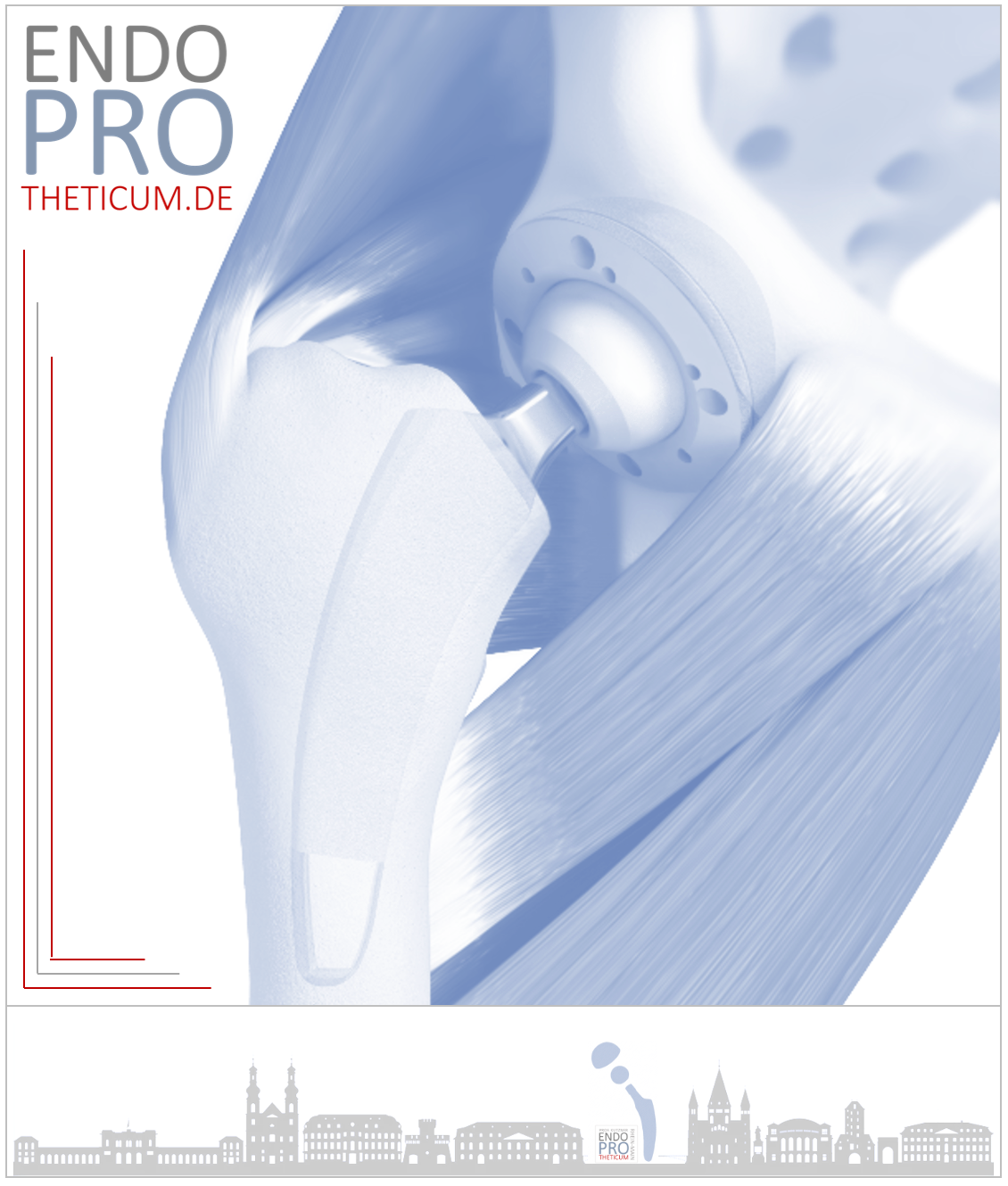Leistenschmerzen: Immer auch an die Hüfte denken
Warum Leistenschmerzen häufig zunächst fehldiagnostiziert werden und das Hüftgelenk gerne übersehen wird.

Leistenschmerzen sind ein häufiges Symptom, das sowohl bei sportlich aktiven Menschen als auch in der allgemeinen Bevölkerung auftritt. Die Ursachen können vielfältig sein und reichen von muskulären Problemen über Nervenreizungen bis hin zu ernsthaften Erkrankungen des Hüftgelenks. Oftmals wird die Hüfte als Ursprung der Beschwerden übersehen, obwohl Hüftpathologien häufig für Leistenschmerzen verantwortlich sind. In diesem umfassenden Blogbeitrag werden wir die anatomische Beschaffenheit des Hüftgelenks detailliert erläutern, die Zusammenhänge zwischen Hüftpathologien und Leistenschmerzen aufzeigen, mögliche Differenzialdiagnosen diskutieren und häufige Fehldiagnosen beleuchten.
Anatomie des Hüftgelenks
Das Hüftgelenk (Articulatio coxae) ist ein zentrales Gelenk des menschlichen Bewegungsapparates und verbindet den Oberschenkelknochen (Femur) mit dem Becken (Pelvis). Es handelt sich um ein Kugelgelenk, das eine hohe Beweglichkeit in mehrere Richtungen ermöglicht und gleichzeitig das Körpergewicht trägt.
Knochenstrukturen
Die Hauptknochenstrukturen des Hüftgelenks sind:
- Femurkopf: Der kugelförmige obere Teil des Oberschenkelknochens, der in die Hüftpfanne passt.
- Acetabulum: Die Hüftpfanne des Beckens, die den Femurkopf aufnimmt.
Diese knöchernen Strukturen bilden zusammen das Hüftgelenk und ermöglichen Bewegungen wie Beugung, Streckung, Abduktion, Adduktion sowie Innen- und Außenrotation.
Knorpel und Gelenklippe
Die Gelenkflächen von Femurkopf und Acetabulum sind mit hyalinem Knorpel überzogen, der als Stoßdämpfer fungiert und reibungsarme Bewegungen ermöglicht. Zusätzlich umgibt das Acetabulum eine faserknorpelige Struktur, das Labrum acetabulare, welches die Gelenkpfanne vertieft und zur Stabilität des Gelenks beiträgt.
Bänder und Kapsel
Das Hüftgelenk wird von einer kräftigen Gelenkkapsel umschlossen, die durch mehrere Bänder verstärkt wird:
- Ligamentum iliofemorale: Verläuft von der Darmbeinsäule zum Femur und verhindert eine übermäßige Streckung des Hüftgelenks.
- Ligamentum pubofemorale: Verbindet das Schambein mit dem Femur und begrenzt die übermäßige Abduktion.
- Ligamentum ischiofemorale: Erstreckt sich vom Sitzbein zum Femur und hemmt die Innenrotation.
Diese Bänder sorgen für die Stabilität des Hüftgelenks und begrenzen extreme Bewegungen.
Muskulatur
Die Bewegungen des Hüftgelenks werden durch eine Vielzahl von Muskeln ermöglicht:
- Flexoren: Muskeln wie der M. iliopsoas beugen das Hüftgelenk.
- Extensoren: Der M. gluteus maximus streckt das Hüftgelenk.
- Abduktoren: Muskeln wie der M. gluteus medius heben das Bein seitlich ab.
- Adduktoren: Muskeln wie der M. adductor longus führen das Bein zur Körpermitte.
- Rotatoren: Muskeln wie der M. piriformis ermöglichen die Drehung des Beins nach innen und außen.
Ein harmonisches Zusammenspiel dieser Muskeln ist essenziell für die Funktionalität und Stabilität des Hüftgelenks.
Zusammenhang zwischen Hüftpathologien und Leistenschmerzen
Leistenschmerzen können oft auf Erkrankungen oder Verletzungen des Hüftgelenks zurückgeführt werden. Dies liegt an der engen anatomischen und funktionellen Verbindung zwischen Hüfte und Leiste. Im Folgenden werden einige häufige Hüftpathologien vorgestellt, die Leistenschmerzen verursachen können.
Koxarthrose (Hüftarthrose)
Koxarthrose bezeichnet den degenerativen Verschleiß des Hüftgelenks, bei dem der Gelenkknorpel zunehmend abgebaut wird. Dies führt zu Schmerzen, die häufig in der Leiste lokalisiert sind und bis in den Oberschenkel oder das Knie ausstrahlen können. Typische Symptome sind Anlaufschmerzen nach Ruhephasen, Belastungsschmerzen und eine eingeschränkte Beweglichkeit des Hüftgelenks. Im fortgeschrittenen Stadium können auch Ruheschmerzen auftreten.
Hüftdysplasie
Bei der Hüftdysplasie handelt es sich um eine angeborene oder erworbene Fehlbildung des Hüftgelenks, bei der das Acetabulum den Femurkopf nicht ausreichend überdacht. Dies führt zu einer Instabilität des Gelenks und kann bereits im jungen Erwachsenenalter zu Schmerzen und einer vorzeitigen Arthrose führen. Leistenschmerzen sind ein häufiges Symptom, oft begleitet von einem Gefühl der Instabilität oder einem "Schnappen" im Gelenk.
Femoroazetabuläres Impingement (FAI)
Das femoroazetabuläre Impingement beschreibt eine Einklemmungssymptomatik im Hüftgelenk, die durch strukturelle Veränderungen am Femurkopf oder am Acetabulum verursacht wird. Es werden zwei Hauptformen unterschieden:
- Cam-Impingement: Eine Deformität des Femurkopfes führt dazu, dass dieser nicht mehr optimal in die Hüftpfanne passt. Dadurch kommt es zu einem mechanischen Konflikt zwischen Femur und Acetabulum, insbesondere bei Beuge- und Drehbewegungen.
- Pincer-Impingement: Eine übermäßig ausgeprägte Hüftpfanne führt zur Einklemmung des Labrum acetabulare und der angrenzenden Gelenkstrukturen.
Beide Formen des FAI können Leistenschmerzen verursachen, die typischerweise bei sportlichen Aktivitäten auftreten und sich bei langem Sitzen oder intensiver Belastung verstärken. Eine unbehandelte Einklemmung kann langfristig zu Knorpelschäden und Arthrose führen.
Labrumläsionen
Das Labrum acetabulare ist eine knorpelige Struktur, die das Acetabulum umgibt und die Stabilität des Hüftgelenks erhöht. Eine Schädigung oder ein Riss des Labrums kann Leistenschmerzen verursachen, die oft als tief sitzend beschrieben werden. Typische Symptome sind ein "Klicken" oder "Schnappen" im Gelenk sowie Bewegungseinschränkungen.
Labrumläsionen können durch Trauma, degenerative Veränderungen oder als Folge eines FAI entstehen. Die Diagnose erfolgt meist durch eine Magnetresonanztomographie (MRT) mit Kontrastmittel.
Bursitis trochanterica
Eine Entzündung der Schleimbeutel im Bereich der Hüfte, insbesondere der Bursa trochanterica, kann zu Schmerzen im lateralen Hüftbereich führen, die in die Leiste ausstrahlen können. Typischerweise sind die Schmerzen bei Druck auf den Trochanter major verstärkt.
Differentialdiagnosen von Leistenschmerzen
Neben hüftbedingten Ursachen gibt es zahlreiche andere Erkrankungen, die Leistenschmerzen hervorrufen können. Dazu gehören:
- Leistenbruch (Inguinalhernie): Eine Vorwölbung von Bauchorganen durch eine Schwachstelle in der Bauchwand kann zu stechenden Leistenschmerzen führen, insbesondere bei Belastung.
- Adduktorenprobleme: Muskelverletzungen oder Sehnenreizungen der Adduktorenmuskulatur sind besonders bei Sportlern häufig und können mit Leistenschmerzen einhergehen.
- Nervenkompressionen: Eine Irritation des N. femoralis oder N. obturatorius kann neuropathische Leistenschmerzen hervorrufen.
- Gastrointestinale Ursachen: Erkrankungen des Darms, wie eine Divertikulitis oder eine Blinddarmentzündung, können ebenfalls Leistenschmerzen imitieren.
Häufige Fehldiagnosen bei Leistenschmerzen
Leistenschmerzen werden häufig falsch diagnostiziert, da sich die Symptome verschiedener Erkrankungen überschneiden. Folgende Fehldiagnosen sind besonders häufig:
- Fehlinterpretation einer Hüftpathologie als Leistenbruch: Gerade frühzeitige Zeichen einer Koxarthrose oder eines FAI werden oft als Leistenhernie fehlinterpretiert.
- Verwechslung mit muskulären Problemen: Häufig werden Adduktorenprobleme diagnostiziert, obwohl eine strukturelle Hüfterkrankung vorliegt.
- Rückenprobleme als Ursache: Manchmal wird ein Bandscheibenvorfall oder eine lumbale Nervenwurzelirritation als Ursache der Leistenschmerzen angenommen, obwohl das Problem in der Hüfte liegt.
Fazit: Leistenschmerzen haben ihren Ursprung häufig im Hüftgelenk!
Leistenschmerzen sind ein komplexes Symptom mit vielfältigen Ursachen. Besonders wichtig ist es, die Hüfte als möglichen Ursprung der Beschwerden nicht zu übersehen. Eine sorgfältige Diagnostik mit klinischer Untersuchung, Bildgebung und gegebenenfalls interventionellen Tests ist essenziell, um die richtige Diagnose zu stellen und eine effektive Therapie einzuleiten. Besonders bei persistierenden oder unklaren Leistenschmerzen sollte immer auch an hüftbedingte Ursachen gedacht werden.
Daher ist es ratsam, frühzeitig einen Hüftspezialisten zu konsultieren, um ernsthafte Erkrankungen auszuschließen und eine gezielte Behandlung zu beginnen. Eine frühzeitige Diagnose kann die Prognose erheblich verbessern und langfristige Einschränkungen verhindern.
TERMIN VEREINBAREN?
Gerne können Sie einen Termin sowohl telefonisch, als auch online vereinbaren.